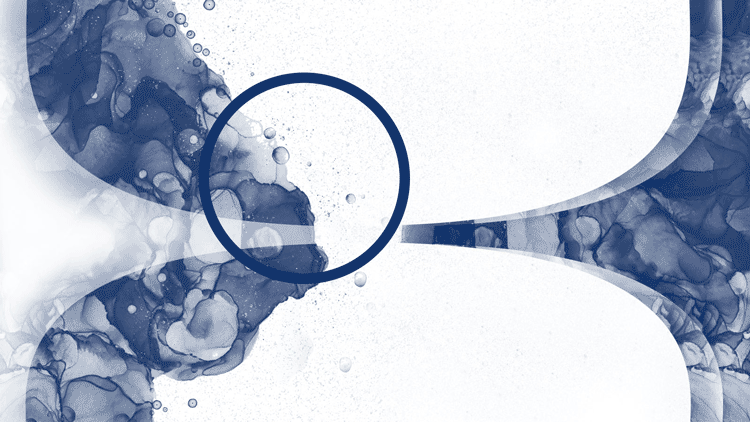Wenn der Kunde seine Finanzberatung selber zahlt, verbessern sich damit seine Chancen auf vorteilhafte Verträge. Eine Garantie ist das aber noch nicht, wie Missstände in der Honorarberatung zeigen. Eine Bestandsaufnahme – und erste Vorschläge zur Lösung.
- Finanzberatung findet in Deutschland nach wie vor überwiegend provisionsfinanziert statt. Nur wenige Menschen zahlen ein Honorar, um eine unabhängigere Beratung zu erhalten.
- In einigen Fällen sind in der Honorarberatung vertragliche Konstruktionen aufgefallen, die zu Lasten der Kundinnen gehen.
- Ein erster Schritt auf dem Weg zu einer stärkeren Verbraucherposition könnte eine Honorarordnung sein – ähnlich der Regelungen wie bei Rechtsanwälten.
Honorarberatung ist hierzulande immer noch ein Nischenmarkt. Und damit bleibt es auch der Gedanke, dass der Kunde seine Finanzberaterin aus der eigenen Tasche zahlt. Die Verhältnisse am Markt zeigen das sehr klar: Rund 200.000 Versicherungsvermittlern, deren Lebensunterhalt von Provisionszahlungen der Anbieter abhängt, stehen nur ein paar hundert Berater gegenüber, die direkt von den Kundinnen bezahlt werden.
Als unabhängige Honorar-Anlageberater – der Begriff ist gesetzlich geschützt – sind bei der Finanzaufsicht deutschlandweit zurzeit lediglich 17 Firmen gelistet. Und Stand 2020 gibt es nur gut 300 zugelassene Versicherungsberaterinnen, die ihre Vergütung nicht über die Produktanbieter, sondern vom Kunden erhalten.
Fakt ist also: Finanzberatung für Privatleute findet in Deutschland aktuell ganz überwiegend provisionsfinanziert statt. Schätzungen gehen von einem Marktanteil von über 98 Prozent aus. Die damit verbundenen Fehlanreize und Folgen sind bereits ausführlich diskutiert worden (wenn auch noch nicht abgestellt). Dazu gehören beispielsweise zu teure und ineffiziente Produkte, zu hohe Vertragsvolumina oder unpassende Angebote.
Die Formel „Honorarberatung = gute Beratung“ geht nicht auf
Im vielen Fällen können solche Probleme des Provisionsvertriebs vermieden werden, wenn Ratsuchende für ihre Beratung selber zahlen. So sehen es viele Experten. Verbraucher kommen in der Regel besser weg, wenn allein ihr Bedarf und ihre Wünsche im Vordergrund stehen – also völlig unabhängig von Anbieterinteressen beraten wird.
Eine Reihe von Beobachtungen weist jedoch darauf hin, dass der einfache Umkehrschluss – vom Kunden bezahlte Honorarberatung = gute Beratung – ebenfalls zu kurz greift. Denn auch bei der Honorarberatung kann es zu erheblichen Fehlanreizen für Berater und Beraterinnen kommen, die den Kunden schädigen.
Das zeigt sich beispielsweise bei Konstruktionen in der Honorarberatung, wenn das Honorar für die Beratung von der Kundschaft weiter gezahlt werden muss, obwohl die durch die Beratung zustande gekommene Versicherung bereits beendet wurde. In solchen Fällen schließt der Ratsuchende nämlich zwei voneinander unabhängige Verträge – einen Honorarvertrag für die Beratung und einen zweiten für die Produktvermittlung. Sie gelten auch nicht automatisch als „verbundene Geschäfte“.
Besonders nachteilig ist diese Konstruktion in Fällen, bei denen das vermittelte Produkt klar mangelhaft oder nicht bedarfsgerecht ist und Kunden den Honorarvertrag für die Beratung trotzdem nicht einfach beenden können. Dabei wirkt es sich ungünstig für Verbraucherinnen aus, dass der Honorarvertrag – juristisch gesehen – kein Werkvertrag, sondern ein Dienstvertrag ist. Das bedeutet: Der Berater schuldet nicht ein bestimmtes Ergebnis, sondern nur das Bemühen darum. Selbst deutliche Mängel des Produkts ermöglichen somit nicht so einfach die Beendigung des Honorarvertrags.
In der Praxis zeigen sich vereinzelt Missstände
Ein in einem Einzelfall bekannt gewordener Trick eines unfairen Honorarberaters besteht darin, seinen Kunden einen „Auftrag zum sofortigen Tätigwerden“ unterschreiben zu lassen. Hierdurch wird die vierzehntägige Widerrufsklausel unterlaufen. Als der Kunde innerhalb der Frist widerrief, verlangte der Berater einen hohen „Wertersatz“ für vorgeblich geleistete Hintergrundarbeiten, zum Beispiel 80 Stunden für die Erstellung einer persönlichen Finanzplanung des Kunden.
Weitere Missstände sind Honorarberatungsverträge, die auf eine sehr lange Laufzeit ausgelegt sind, keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit vorsehen und damit einen regelrecht knebelnden Charakter haben. Dabei steht die Honorarhöhe in manchen Fällen nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Sparleistung oder zum zeitlichen Aufwand.
Schließlich gibt es noch höchst kritikwürdige Honorarberechnungen auf so genannter Mehrwertbasis. Hier wird Ratsuchenden vorgerechnet, welchen höheren Vermögensendwert sie durch eine „optimierte“ Anlage oder andere Vertragstypen über eine längere Laufzeit erzielen könnten. Einen Teil dieses (rein hypothetischen) Mehrwertes beansprucht die Honorarberaterin dann allerdings schon vorab – meist in Form einer Einmalzahlung, die zeitnah nach Abschluss des vermittelten Nettovertrages fällig wird.
Solche Beispiele zeigen: Das Label Honorarberater und eine direkte Bezahlung durch die Kundin allein genügen nicht, um eine faire und gute Beratung zu sichern. Aus diesem Grund erscheint eine nähere Analyse von Anreizstrukturen und Erscheinungsformen der Honorarberatung unverzichtbar.
Unabhängige Beratung kann heißen: besser gar kein Vertrag
Ein hilfreiches Gedankenkonstrukt zu diesem Zweck ist die Unterscheidung zwischen verkaufsorientierter Finanzvermittlung einerseits und einkaufsorientierter Finanzberatung andererseits. Anders als im Firmengeschäft bestehen bei der Finanzberatung im Privatkundenbereich nämlich ganz überwiegend nur Vertriebs- und keine Einkaufsstrukturen – mal abgesehen von wenigen Ausnahmen wie den Verbraucherzentralen oder der Stiftung Warentest. Auf spezialisierte Einkäuferinnen im Finanzdienstleistungsmarkt können lediglich extrem wohlhabende Privatleute zurückgreifen, zum Beispiel über so genannte „Family-Offices“.
Schon deshalb wäre es eine irreführende Vereinfachung, wenn man Honorarberatung im Privatkundenbereich prinzipiell mit einer einkaufsorientierten Beratung gleichsetzte. Denn damit eine „echte“ einkaufsorientierte Beratung vorliegt, reicht der Verzicht auf Provisionsfinanzierung allein nicht aus. Dieser ist lediglich eine notwendige, aber eben noch keine ausreichende Bedingung.
So ist die Honorarberatung in ihrer Erscheinungsform als Honorarvermittlung oftmals als vertriebsorientiert zu betrachten. Das heißt: Sie verfolgt letztlich das Ziel, dem Kunden provisionsfreie Nettoprodukte zu verkaufen. Für den Kunden ist das nicht immer die beste Lösung. Denn das Ergebnis einer unabhängigen Beratung könnte ja auch sein, dass überhaupt kein Produktabschluss erforderlich ist.
Es zeigt sich: Eine Honorarberatung muss nicht automatisch zum Vorteil der Verbraucherin sein. Vielmehr sollte die reine Beratungsleistung generell von möglicherweise folgenden Produktabschlüssen getrennt und unabhängig sein.
Unter Berücksichtigung dieses Punktes ist ein Teil der Honorarberater offensichtlich nicht als einkaufsorientiert zu qualifizieren. Gefühlt – nicht wissenschaftlich bewiesen – wächst allerdings gerade dieser Teil und damit die Gefahr, dass die positive Besetzung des Begriffs Honorarberatung durch „clevere Konzepte“ zu Lasten von Verbraucherinnen und Verbrauchern genutzt wird.
Wirrwarr von unklaren Begrifflichkeiten
Schuld daran trägt auch der Gesetzgeber, der für Finanzvermittler und -beraterinnen einen wahren Wirrwarr unklarer Begrifflichkeiten schuf: Eine Krux ergibt sich heute schon aus diesen für Laien vollkommen unklaren Bezeichnungen.
Und noch schlimmer: Wer da draußen im Land unterscheidet gedanklich überhaupt zwischen Berater im reinen Kundeninteresse einerseits und Vermittler (vulgo: Verkäufer) andererseits?
Vor diesem Hintergrund erscheint das Idealbild einer „neutralen Beratung“ im Sinne eines fairen Interessensausgleichs zwischen Anbieter- und Nachfragerseite oft als wenig realistisch. Die theoretische Rolle des Maklers kommt diesem Idealbild zwar nahe. Die Praxis jedoch zeigt, dass eine überwiegende Interessenabhängigkeit des Maklers von der Anbieterseite besteht – zumindest finanziell. Als Gründe seien nur die Stichwörter Provisionsfinanzierung, Dauergeschäftsverhältnis und Staffelvergütung genannt. Sie stehen einer strikt einkaufsorientierten Beratung von Kundinnen entgegen.
Kunden erkennen, wenn jemand Stunden schindet
Als Kernproblem bleibt das Informationsgefälle zwischen Finanzfachleuten und Kunden. Dieses Gefälle kann auch bei einer scheinbar einkaufsseitigen Beratung zur Verbraucherschädigung führen, insbesondere durch Fehlanreize für Beraterinnen wie überhöhte Honorarsätze oder aufgeblähte Stundenkontingente.
Immerhin bringen Verbraucher hinsichtlich des Schindens von Stunden oder überhöhten Stundensätzen schon Erfahrung aus anderen Dienstleistungsbereichen mit – sei es mit der Haushaltshilfe, der Anwältin oder dem Handwerker. In solchen Fällen können viele Privatleute – wie im Geschäftsverkehr üblich – gegensteuern. Jedenfalls besser als bei Provisionen, die Anbieter und Vermittler vereinbaren. Im klassischen Provisionsvertrieb ist der Kunde regelmäßig bloß der zahlende Dritte.
Ein erster – aber entscheidender – Schritt hin zum selbstbestimmten Kunden könnte daher eine Honorarordnung für Finanzberaterinnen sein. Genau so, wie man das von anderen freien Berufen wie beispielsweise Rechtsanwälten kennt. Der unabhängige Finanzberater, das zeigen solche Vorbilder, muss kein Traum bleiben. Bis dahin sollten Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Finanzberatung allerdings zweimal hinschauen und lieber einmal zu viel nachfragen.

Prof. Hartmut Walz
Professor Hartmut Walz lehrt Betriebswirtschaft und insbesondere Bankbetriebslehre, Finanzdienstleistungen und Anlagepsychologie an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. Sein Fokus liegt auf der Verhaltensökonomie im Bereich Finanzprodukte. Als engagierter Verbraucherschützer untersucht er Angebote von Finanzunternehmen.

Britta Langenberg
Britta Langenberg ist gelernte Wirtschaftsjournalistin. Nach dem Studium in Köln und Bamberg hat sie lange für renommierte Magazine gearbeitet, etwa für Finanztest (Stiftung Warentest) und Capital. 2019 wechselte sie zu Finanzwende – und ist dort insbesondere für die Themen Versicherung & Vorsorge zuständig.