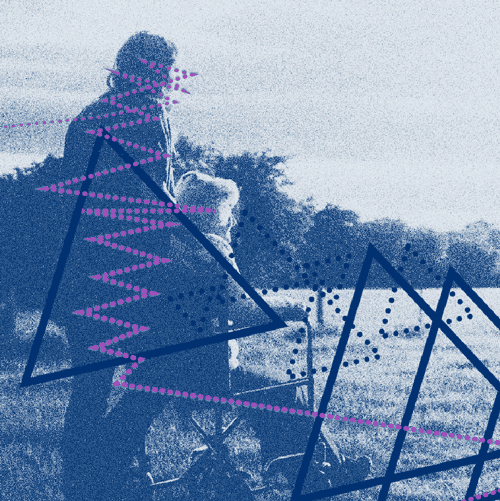Private-Equity-Beteiligungen an Arztpraxen in Deutschland
Profite vor Patientenwohl
- Das Eindringen der Finanzmarktlogik betrifft viele Bereiche. Auch Arztpraxen sind immer öfter Zielscheibe von Private-Equity-Firmen.
- Finanzwende Recherche hat sich fünf Beispiele angeschaut. In diesen Fällen weist die Mehrheit eine hohe Verschuldung auf. Laut anderer Untersuchungen können durch die Aufkäufe sogar regional monopolartige Strukturen entstehen.
- Private Equity gefährdet so nicht nur die freie Arztwahl und die Qualität der medizinischen Versorgung, sondern auch die Versorgungssicherheit.
Schon die Finanzwende-Studie zu Private-Equity-Firmen im Pflegebereich hat gezeigt: Immer öfter kaufen sich solche Geldgeber*innen auch in Bereiche der Daseinsfürsorge ein. Eine neue Studie von Finanzwende Recherche zeigt nun, welche Auswirkungen die Profitlogik von Private-Equity-Investor*innen auf Arztpraxen und damit die medizinische Versorgung hat.
Die Studie
Im Gesundheitswesen gibt es enormen Investitionsbedarf. Dabei setzt die deutsche Gesundheitspolitik auch auf private Investitionen. Und so nehmen Private-Equity-Investitionen auch in der ambulanten Gesundheitsversorgung, also in Arztpraxen, zu. Von ihrem Einstieg erwarten die Geldgebenden oft eine Rendite um die 20 Prozent.


Finanzwende Recherche hat im Rahmen der neuen Studie „Profite vor Patientenwohl – Private-Equity-Beteiligungen an Arztpraxen in Deutschland“ an fünf Beispielfällen aus unterschiedlichen medizinischen Bereichen genauer beleuchtet, mit welchen Mitteln Private Equity Profite im Gesundheitsbereich erzielt.
Die Ergebnisse
Die Fallbeispiele der Studie verdeutlichen: Private-Equity-Firmen können nicht nur zu hohen Schulden bei den Praxen-Konzernen führen. Sie können auch negative Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und die Qualität der ärztlichen Behandlung haben.
Denn Interessenskonflikte werden wahrscheinlicher, wenn ein neu gebildeter Konzern wie im Fall Zytoservice ärztliche Versorgung und Medikamentenherstellung verbindet. Der Private-Equity-Besitz der Dr. med. Kielstein Praxen-Unternehmen verdeutlicht zusätzlich, wie eine Bündelung verschiedener medizinischer Bereiche in einem Medizinischen Versorgungszentrum dazu führen kann, dass die Allgemeinmedizin eine Art „Verteilerfunktion“ zwischen Allgemein- und Fachärzt*in einnimmt. So kann die freie Wahl der ärztlichen Behandlung für Patient*innen eingeschränkt werden, die Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen ist in Gefahr.
Der Fall des Augenheilkunde-Konzerns Ober Scharrer macht die Kurzlebigkeit der Private-Equity-Beteiligungen deutlich: Trotz operativer Verluste wurde das Unternehmen immer wieder profitabel weiterverkauft. Dabei sieht Ober Scharrer Operationen als „Werttreiber“ und nutzt die Anzahl bestimmter Operationen als Steuerungsgröße. Solche gezielten Anreize zu bestimmten Eingriffen erhöhen den Renditedruck der behandelnden Ärzt*innen und rücken damit den Profit und nicht das Wohlergehen der Patient*innen in den Fokus der medizinischen Behandlung.
Die Beteiligung sehr profitorientierter Investor*innen kann wie im Fall des Konzerns Artemis auch zu einer negativen Kapitalentwicklung führen. Rund die Hälfte der Kredite entfallen auf Gesellschafter-Darlehen und die Eigenkapitalquote liegt mittlerweile im negativen Bereich, was auf eine stark angespannte wirtschaftliche Lage des Konzerns hindeutet.
In einigen Regionen in Deutschland haben Private-Equity-Firmen durch Zukäufe außerdem bereits heute monopolartige Strukturen geschaffen.
Handlungsmöglichkeiten
Die Studie analysiert Handlungsmöglichkeiten, die den Einfluss von Private Equity im Bereich der Arztpraxen einschränken könnten.
Einmal könnten die politischen Entscheidungsträger*innen die Umstände, unter welchen Praxisaufkäufe zulässig sind, stärker regulieren. Momentan reicht es, eine Klinik in Süddeutschland zu besitzen, um in Norddeutschland Medizinische Versorgungszentren aufzubauen. Damit solche Zentren ihrem ursprünglichen Sinn dienen und den Patient*innen einen Mehrwert bieten, indem sie beispielsweise Überweisungen erleichtern, könnten regionale Beschränkungen der Praxiszukäufe sinnvoll sein. Auch die Anzahl der Arztsitze, welche von einem einzelnen Konzern betrieben werden, könnte die Politik einschränken.
Zudem könnten strengere Regeln dafür sorgen, dass Private-Equity-Firmen Arztpraxen nicht langfristig schaden können. Dazu gehört eine Begrenzung der Kreditaufnahme der Praxen-Konzerne, damit diese sich nicht übermäßig verschulden. Zudem könnte es Haftungsregeln geben, damit die Geldgebenden nach dem Verkauf des Unternehmens nicht direkt aus der Verantwortung sind.
An vielen Stellen ist im Moment unklar, wer überhaupt in deutsche Praxen investiert hat. Um das ganze Ausmaß des Einflusses von Private Equity im deutschen Gesundheitssektor zu ermitteln, wäre ein Transparenzregister eine Möglichkeit. Dieses müsste die wirtschaftlichen Berechtigten und damit die Eigentümer*innen der Medizinischen Versorgungszentren erfassen. Transparente Eigentumsstrukturen sind wesentlich für wettbewerbsrechtliche Maßnahmen – denn sonst entstehen womöglich Praxen-Monopole unter dem Radar der Aufsicht. Außerdem würde ein Transparenzregister sichtbar machen, wenn Eigentümer*innen aus steuerrechtlichen Gründen in Offshore-Finanzzentren sitzen.
Die Möglichkeit zur Umsetzung der aufgezeigten Handlungsoptionen besteht direkt: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat einen Gesetzentwurf angekündigt, durch den der Einfluss von Finanzinvestor*innen im Bereich der Arztpraxen zurückgedrängt werden soll.
Private-Equity-Investor*innen in der Pflege
Im Rahmen einer Studie hat sich Finanzwende Recherche angeschaut, wie Private-Equity-Investor*innen im Pflegebereich agieren. Die Erkenntnis: Die Trickliste der Investor*innen ist lang – mit erheblichen Folgen für das deutsche Pflegesystem.
Rendite mit der Miete: Finanzmärkte und die Wohnungskrise in Deutschland
Das Phänomen der Finanzialisierung greift auch im Immobilienbereich immer mehr um sich. Welche Auswirkungen hat das für Mieter*innen und den Wohnungsmarkt?
Finanzialisierung: Profit über Gemeinwohl
Immer mehr Bereiche des Lebens werden der Logik der Finanzwelt unterworfen. Was eine Firma tatsächlich macht und welchen Nutzen sie für die Gesellschaft hat, spielt so kaum noch eine Rolle. Alles wird auf maximalen kurzfristigen Profit getrimmt.
Die Finanzialisierung der Mikrokredite
Von einer guten Idee zum internationalen Finanzprodukt? Kommerzielle Interessen haben den Mikrokreditsektor erreicht und am rasant wachsenden Markt lässt sich ein zunehmendes Eindringen der Finanzmarktlogik beobachten.
Profit im Stadion: Fußball und Finanzialisierung
In Deutschland war es für Finanzinvestor*innen lange schwierig, in den Fußball einzusteigen. Das könnte sich nun ändern. Denn im Fußball tummeln sich immer häufiger Finanzinvestor*innen mit einem Fokus auf der Gewinnmaximierung. Langfristig zeigt der Einfluss des Finanzsektors im Fußball negative Auswirkungen.